Rückschau
Veranstaltungen Winter 2022 / Frühling 2023
„Raum und Leere“ in Remetschwiel im Schwarzwald am 17. Dezember 2022
in der Ausstellung mit Bildern von Herbert Giller und Oliver Pasquare (Gitarre)
https://seminarhaus-remetschwiel.de/ Aufzeichnung Vimeo
„Vor-Premiere NachtMeerFahrt“ im sphères / Zürich am 7. März 2023
mit Willi Grimm (Didjeridoo) https://www.spheres.cc/
„Premiere NachtMeerFahrt“ im Atelier für Kunst und Philosophie / Zürich am 16. März 2023
mit Martin Kunz (Klavier) https://www.kunstundphilosophie.ch/
„Lesung und Klang“ im Klangkeller Bern am 25. März 2023
mit Willi Grimm (verschiedene Naturton Instrumente ) https://www.klangkeller-bern.ch/
Aufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=YtAID2BlK9o
„Buchvorstellung NachtMeerFahrt“ in der Werkstatt 7 / Zürich am 31. März 2023
https://www.mfo-denkwerkstatt.ch
„Wort und Klang“ im Teatro Di Capua / Embrach am 15. April 2023
mit Willi Grimm (Didgeridoo und verschiedene Naturton Instrumente )
im https://www.teatrodicapua.ch/ Aufzeichnungen: https://vimeo.com/user/965734/folder/22385654
„Eine Welt von Zwischentönen“ am 28.09.2024 in Waldshut mit Steffi Spinas (Klavier)
im www.klavierhaus-hochrhein.de https://vimeo.com/1018737786
Rückschau „Raum und Leere„
Malerei und Zeichnungen Herbert Giller
Text und Lesung Lilien Caprez-Girsberger
Vernissage 17.12.22 um 18:00 bis 22.12.2022
D-79809 Weilheim Remetschwiel
Seminarhaus-Remetschwiel
https://www.seminarhaus-remetschwiel.de/
Aufzeichnungen : https://vimeo.com/user/965734/folder/22385696
Die Bilder von Herbert Giller lassen sich in verschiedene Werkgruppen einteilen
Struktur – Raum und Fläche
Farbe und Leerheit
Raum – Landschaft
Übergänge
Bewusst gewählt bleibt die fortlaufende Geschichte in den gelesenen Textpassagen des Buches «NachtMeerFahrt» von Lilien Caprez verhüllt, um sie assoziativ mit den Bildern zu verknüpfen. Aus der Perspektive unterschiedlicher Ebenen – der Sprache und der Malerei – wird von beiden Künstlern auf Wesensverwandtes hingewiesen. Daraus entsteht ein leerer Raum, der sich beim Betrachten und Hören mit aufblitzenden Impressionen und Gedanken füllt.
Wer neugierig auf die ganze Geschichte wird, kann diese ab Ende Februar 2023 lesen, wenn
NachtMeerFahrt
Ein Weg in die Nähe des Todes und in die Fülle des Lebens
beim Bucher Verlag erscheint und im Buchhandel erhältlich ist.
https://www.bucherverlag.com/

LEERE
«Stirb und Werde», dieses rigorose Zurücklassen von etwas Vertrautem – egal ob geliebt oder ungeliebt – ohne zu wissen, was wird. Da zu sein mit leeren Händen, ohne zu wissen, womit und ob sie sie sich wieder füllen werden. Und doch voll ängstlich süsser Neugier auf das noch Unbekannte. Erfrischung? Ernüchterung? Beschränkung? Erweiterung?

Nach dem Essen ergab es sich, dass Sascha anfing, Sirtaki zu tanzen. Als echter Grieche kann man das natürlich. Er hatte die passende Musik mitgebracht und meine Mutter konnte nach vielen Jahren in Griechenland durchaus mithalten. Angeheizt von der immer wilder werdenden Musik packten sie ein paar leergegessene Teller und schmetterten sie mit Karacho auf den Fussboden. Das sollte Glück bringen.
Weil es altes Geschirr vom Trödelmarkt war, griffen wir nicht ein. Sie forderten uns ungeduldig auf, endlich mitzutanzen und gemeinsam die restlichen Teller zu zerdeppern, statt so lahm am Tisch zu sitzen. Das Blut gefror uns in den Adern, je mehr Teller beim Aufprall auf dem uralten Riemenparkett in tausend Stücke zersplitterten. Wir blieben reglos sitzen, zu Salzsäulen versteinert.
Es hatte nichts von der Lebensintensität und der Liebe zum Leben eines Alexis Sorbas an sich, der selbst im Scheitern das Leben feiert.
Auch wenn sie es als das verkauften.
Wir sahen zerlumpt und aus der Form gefallen aus. Deshalb erkannte uns der Chauffeur auch nicht, der in der Hotellobby Ausschau nach fein herausgeputzten Gästen hielt.
Schlussendlich gingen wir auf ihn zu und wurden auf einer halsbrecherischen Fahrt in der hochglanzpolierten schwarzen Mercedes-Staatskarosse durch die leere Stadt, die ärmlichen Vororte, durch karges Wüstenland bis zu einem von abweisenden Mauern umzäunten Hochsicherheitsareal gefahren. Durch ein gewaltiges Tor erhielten wir Einlass ins Innere, ein fruchtbares Paradies inmitten der Wüste Gobi. An der prunkvollen Villa des Premiers vorbei gelangten wir zu dem Gebäude, in dem Staatsempfänge abgehalten wurden. Ein langgezogener flacher monotoner sowjetischer Repräsentationsbau, in seinem Grau einzig vom roten Teppich unterbrochen, der die flachen Stufen zum Eingang in die weitläufige Halle schmückte.
Oben stand der Premierminister und empfing uns wie Staatsgäste.

Nach Tagen in der Ewigkeit, in denen wir in eine gefüllte Leere gesunken waren, sahen wir ein Schiff. Und immer mehr Schiffe. Und Vögel. Wir näherten uns Land, dem Ort, an dem Menschen in all ihrer Geschäftigkeit leben. Wir konnten die Küste zwar noch nicht sehen, aber die auftauchenden Schiffe zeugten von menschlicher Zivilisation und auch die Vögel verwiesen auf die Nähe von Land, das – ebenso wie für die Menschen – ihr Lebensraum ist. Wir fuhren durch eine letzte Nacht und stellten uns noch im Dunkeln an die Reling, wo wir die Dämmerung erwarteten. Bei den ersten Lichtstrahlen konnten wir im bläulichen Dunst Ufer ausmachen. Ein aufregender Moment, der unsere Herzen hüpfen ließ. Endlich! Andererseits spürten wir eine Wehmut über das Entschwinden unserer Geistesverfassung im Niemandsland des Meeres. Wir hatten eine Direktheit und Nacktheit gestreift, eine Realität, die nichts beschönigt, ein Zwischen-Land, das nicht-menschliche Züge trägt und etwas Unaussprechliches berührt.

Unbefangen wie Kinder schwatzten und lachten die Frauen, die sich mit erwartungsvollen Augen – in einem kleinen Raum zusammengepfercht – versammelt hatten. Sie waren unverhohlen neugierig, mich kennenzulernen. Sodann wurde mir mitgeteilt, dass ich eine Ansprache halten solle. Ich fragte «wann?» und erhielt die Antwort «jetzt». Ohne Zeit, mir etwas zu überlegen, geschweige denn vorzubereiten, fühlte ich mich im ersten Augenblick völlig überrumpelt. Mir war klar, dass ich in fünf Minuten kein gedankliches Gerüst entwickeln konnte. Das machte mich nervös. Doch dann fiel mir unverhofft Emaho ein, der sich vor seinen Reden völlig von seinen Gedanken leert und in diesem Zustand aus dem Moment der Begegnung mit den Anwesenden die richtigen Worte findet. Ich war erleichtert und froh, dass ich mich in dieser Sekunde daran erinnerte und wusste, dass ich nur das, und genau nur das, jetzt ausprobieren wollte.
So sammelte ich mich in mein Innerstes und liess alle Gedanken fahren und versuchte, mich für die unmittelbar bevorstehende Zusammenkunft mit den quirligen, ungeduldig wartenden Frauen zu öffnen. Als ich in den mit offenen, blitzenden, arglos lachenden Augen und gespannter Wissbegier gefüllten Raum trat, schmolz meine Aufregung, und ich konnte direkt aus meinem Herzen sprechen. Die Worte flossen mir von unbekannter Quelle zu. Ich schaute mir zu, wie ich die Gedanken beim Sprechen verfasste ohne das Ende des Satzes schon zu kennen. Ein ungeahntes Glücksgefühl ergriff mich.
In unserem körperlichen Lähmungszustand kämpften wir mit dem Einschlafen und den in uns umherwirbelnden Halluzinationen. Als die Wirkung etwas nachliess und wir, ohne etwas von dem Opium zu kaufen,gehen wollten, bedrohte uns der Händler mit einem Messer. Wir wussten, dass wir in dem menschenleeren gottverlassenen Armutsviertel sozusagen keine Chance hatten. Nur mit Mühe und Not schafften wir es, in der Dunkelheit zu fliehen. Ich war damals siebzehn Jahre alt.
Gleichzeitig konnte ich mich nicht des Gefühls erwehren, dass der Mann ein Alkoholiker ist. Ich hatte eine flüchtige, nicht genauer zu definierende suchtgeschwängerte Energie wahrgenommen, die mich auf diese Idee brachte. Später erfuhr ich, dass der Mann tatsächlich ein Alkoholiker war, der auf der Intensivstation dringend Nachschub brauchte, um in seinem akuten Krankheitszustand nicht wegen Entzugserscheinungen zu kollabieren.
Der Mann und seine sonor-stimmige Frau stiessen immer wieder miteinander an. Ich hörte die Gläser klingen. Nach weniger als zehn Minuten kam der Pfleger zurück und rief verblüfft: «Was? Die Flasche ist schon leer?»

Manchmal hatte ich beim Klavierspielen unfreiwillige Zuhörer. Die Kellner und Kellnerinnen räumten die von den Gästen mit Essensresten, zerknitterten Servietten, halbleeren Gläsern und blankgeputzten Tellern zurückgelassenen Tische ab, deckten sie neu ein oder staubsaugten die Krümel weg. Sie fühlten sich nicht von mir gestört und ich mich nicht von ihnen. Jeder tat das Seine.
Es war Pflichtprogramm, psychologisches und spirituelles Pflichtprogramm gewesen, Rico endlich gehen zu lassen. In ihrer Eigenschaft, letztlich von aussen auferlegt zu sein, hatte die Pflichteine abgründige Leerstelle in mich getrieben. Ein Loch, das unersättlich danach schrie, wieder und wieder mit der Bittersüsse der Idealisierung und Nostalgie gefüllt zu werden.
Das durchaus überzeugende Konzept von geistiger Gesundheit, zu dem ein Annehmen der konkreten Realität – auch wenn sie schmerzlich ist – gehört, war unzählige Male in unzähligen Variationen an mich herangetragen worden. Ich wollte dieser Idee so gerne folgen, aber sie konnte das gefrässige Loch meinerBegehrlichkeit nicht stillen.Sie war lediglich Gedanke, blutleer und erzwungen. Pflicht eben.
Seit meiner Initiation erst sitze ich allein allabendlich an meinem langen Tisch. Er ist schon immer mein «Tisch der Sehnsucht» gewesen. Das Gedicht von Novalis «Wenige wissen das Geheimnis der Liebe» hing jahrelang eingerahmt an der Wand in meinem Wohnzimmer.
«Hätten die Nüchternen
Einmal gekostet,
Alles verliessen sie,
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nie leer wird.»
Jetzt also sitze ich wirklich allein dort, erlebe mein Allein-Sein. Davor war Rico immer auch «da». Ich bemerkte es erst als er nicht mehr «da» war. Bis zu unserer Trennung an der Grenze zum Tod war er immer «da» gewesen, obwohl er nicht mehr da war. Er hörte einfach nicht auf, immer noch «da» zu sein.
Nach unserem Auseinandergehen. Blieb er da.
Nach unserer Scheidung. Blieb er weiterhin da.
Nach seinem Tod sass er, dessen ungeachtet, mit am Tisch, leistete mir Gesellschaft, vermittelte mir ein wohlig schmerzliches Gefühl. Wohlig, weil er «da» war. Schmerzlich, weil er nicht da war.
Jetzt wird es mir langweilig, so allein am Tisch, und ich bleibe nicht mehr sehr lange – wie früher – dort sitzen, wenn ich zu Ende gegessen und getrunken habe. Der «Tisch der Sehnsucht» ist er nach wie vor, und ich beginne mich zu fragen, wonach ich mich sehne. Jetzt, nachdem das wehmütige Verlangen nach Rico zu Ende gegangen ist.
Ein leerer Raum öffnet sich….
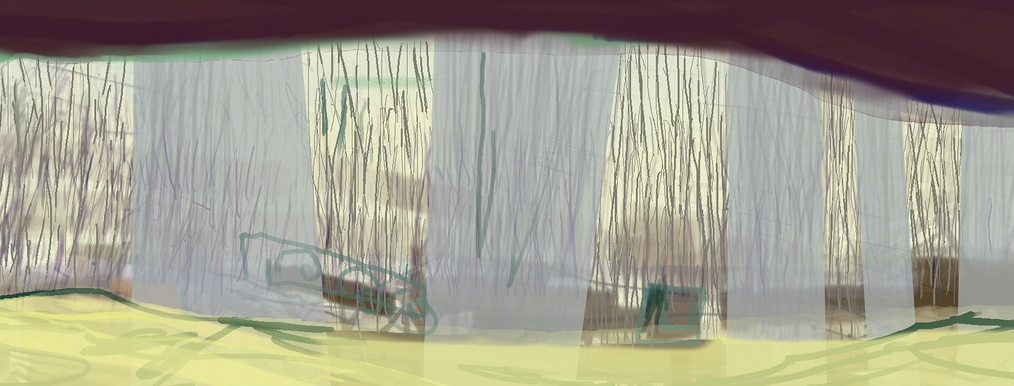
RAUM
«Wohin der Weg?
Kein Weg!
Ins Unbetretene,
Nicht zu Betretende.»
Faust, Johann Wolfgang von Goethe

Hatte ich «gewusst», was auf mich zukommen würde? Hatte mein Inneres gewusst, dass ich einen Raum betreten würde, in dem es keinen Weg gibt?
Einen Raum, der unbetreten, ohne Spuren, ist. Nicht zu betreten,
gefährlich und ungewiss. In dem es
keine Erfahrung als Orientierungshilfe gibt, keine Leitplanken,
nichts Bekanntes.
Einen Raum, in dem ich mich in einer untrennbaren Gleichzeitigkeit von Fühlen, Denken und Handeln bewegen würde, geleitet von zwei in ihrer Natur äusserst unterschiedlichen Kräften.
Die eine Kraft, die des schieren Überlebenswillens, wollte weiterleben, hier auf der Erde, eingebunden in Raum, Zeit und Gravitation, inkarniert in meinen physischen Körper. Sie wollte es um jeden Preis. Sie kämpfte mit grauenvoller Todesangst und bettelte um ein Weiterleben: «Ich will weiterleben! Bitte!»
Die andere Kraft kam aus einer gänzlich anderen Quelle. Sie entsprang nicht meinem Ich. Ich erlebte sie als Gegenüber, ausserhalb von mir. Sie war neutral und gleichzeitig voller Liebe und Mitgefühl für mich, für mein Leben, so wie ich es bis zu diesem jetzigen lebensbedrohlichen Moment gewoben und gelebt hatte. Auch sie wollte mein Weiterleben. Aber aus völlig anderen Gründen. Ihr ging es nicht einfach um den Erhalt meines biologischen Lebens, das der Überlebenswille unter allen Umständen instinktiv beschützen und bewahren will. Sie wollte es aus Mitgefühl für mein Ringen um den unerbittlich rufenden nächsten Schritt auf meinem Lebensweg.
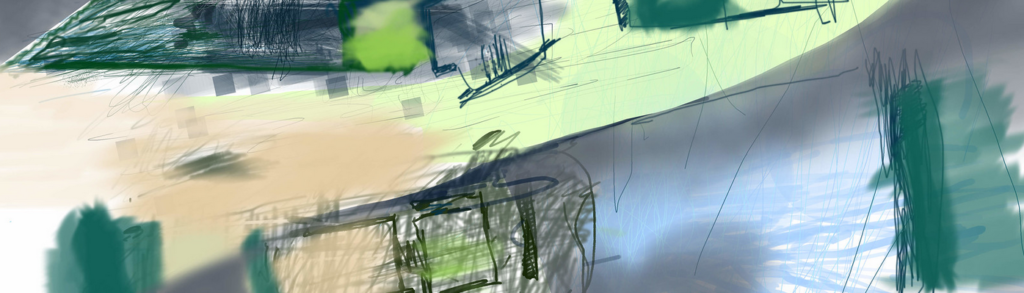
Es gab deutliche Bezüge zu meiner Vergangenheit vor meinem ersten Schritt aus dem lähmenden Dogma «Wir Frauen leben nicht allein».
Mein Versuch, daraus auszubrechen, fing bereits in meiner Kindheit an. Schon damals hatte ich mich entschieden, anders als meine Mutter zu sein. Sie hatte einen heimlichen Geliebten, der täglich anrief, wenn Peter nicht zuhause war, oftmals sogar mehrere Male. Ich war etwa acht Jahre alt. Nicht selten nahm meine gut vier Jahre ältere Schwester das Telefon ab, sprach einen Moment lang mit ihm und reichte dann den Hörer an meine Mutter weiter. Unleugbar ahnte ich etwas. Das vor allem auch, weil meine Mutter und meine Schwester so oft tuschelnd die Köpfe zusammensteckten und mich von ihrem raunenden Gekicher immer ausschlossen. Ich konnte aber nicht benennen, was genau ich da witterte. Schliesslich war ich ja erst acht oder neun. An einem Nachmittag klingelte das Telefon wieder. Ich nahm den Hörer ab, neugierig, ob meine diffuse Vermutung stimmte. Eigentlich «wusste» ich schon, was los war. Es war der Geliebte meiner Mutter. Er fragte mit freundlicher Stimme nach ihr und wollte ein paar Worte mit mir wechseln. Ich weigerte mich, auch nur einen Satz mit ihm zu sprechen, weil ich um keinen Preis zur Verräterin an Peter werden wollte. Tonlos rief ich sie. Dann hörte ich sie mit ihm turteln und flirten noch bevor ich aus dem Zimmer gegangen war. Mir wurde zum Übergeben schlecht, und ich verliess den Raum.
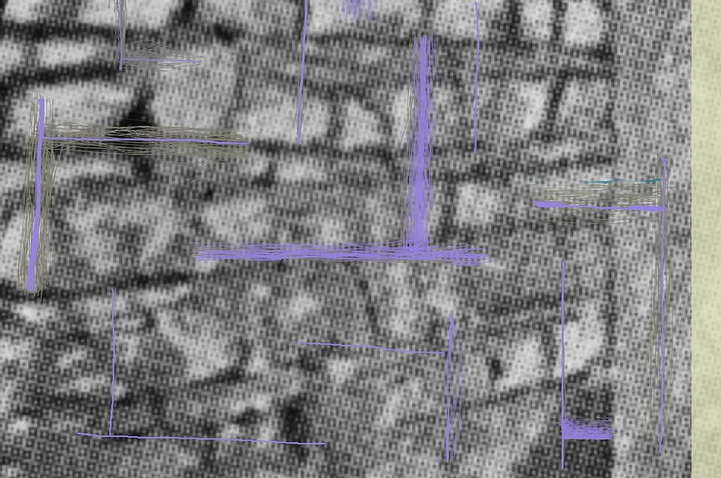
Bevor der Deckel des Sarges endgültig geschlossen wurde und man sie danach in die Kirche zum Abdankungs-Gottesdienst karrte, ging ich in den Aufbahrungsraum, um von ihr Abschied zu nehmen. Ich war allein mit ihr in dem gekühlten, muffig riechenden Raum, dessen abgestandenen Gestank weder die Kälte noch der Parfumduft überdecken konnte und trat an sie heran.
Sie lag in ihrem edlen festlichen Lieblingskleid aus dunkelblauem Chiffon da, umgeben von schnuckeligen Plüschtieren, selbstgepflückten Wiesenblumen und kleinen bedeutsamen Gegenständen. Meine Mutter hatte ihr ihren hübschen filigranen Schmuck angelegt. So wie sie dalag, sah sie beinahe friedlich aus.
Ich richtete laut ein paar Sätze des Abschieds an sie. Ich weiss nicht mehr was ich sagte, aber es waren freundliche Worte. Währenddessen schaute ich ihr ins tote Gesicht. Urplötzlich richtete sie ihren Kopf auf und versetzte mir mit der flachen rechten Hand eine saftige Ohrfeige. So blitzschnell wie der Spuk gekommen war, war er auch wieder weg. Als sei nichts gewesen. Sie lag wieder ruhig und tot im noch offenen Sarg.
Eine unglaubhafte Tollheit. Hanebüchen, himmelschreiend. Abwegige Fantasterei?
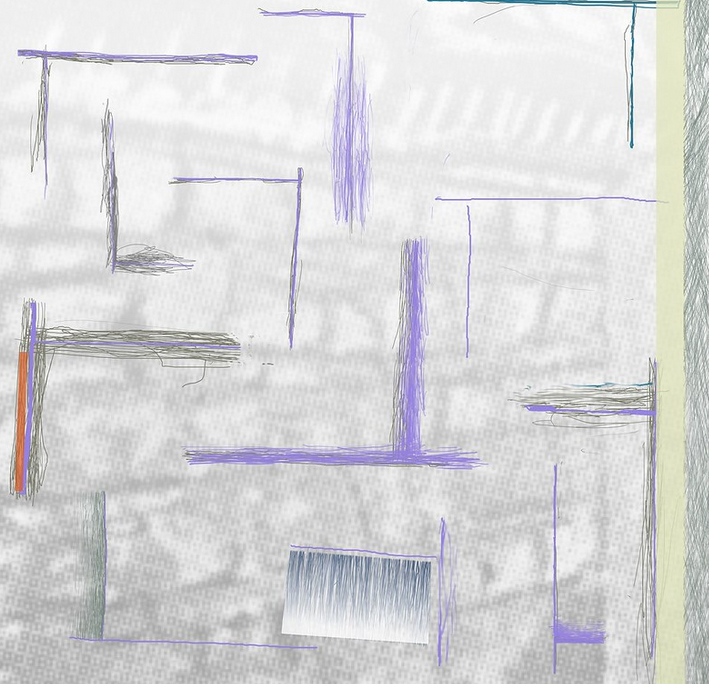
Kurz darauf trug es sich zu, dass mich eines Nachts ein fürchterliches Gepolter aus dem Schlaf aufschrecken liess. Ich traute meinen Ohren nicht. Was war das? Perplex blieb ich mucksmäuschenstill im Bett liegen und lauschte gespitzt durch die nächtliche Tür in den Nebenraum. Es war nichts zu hören. Doch dann fing das Gepolter wieder an. Es hörte sich an, als würde jemand die Möbel lärmend herumrücken. Ich war jedoch allein in der Wohnung. Selbst wenn ich Besuch gehabt hätte, wäre der wohl kaum auf die Idee gekommen, mitten in der Nacht meine Möbel umzustellen.
Was aber war es dann? Schlagartig stellte sich die Gewissheit ein, dass es der Geist meiner Grossmutter ist, die immer noch mit allen Mitteln versuchte, mich zu bannen und im Familienfluch gefangen zu halten. Mit diesem Gedanken mischte sich mehr und mehr Empörung in meine anfängliche Verdutztheit. Ich hatte daran nicht den leisesten Zweifel. Schliesslich lag ja ihr Teppich dort.
Wütend und dennoch fest in meiner Stimme fuhr ich sie durch die geschlossene Tür an: «Hör auf der Stelle auf. Du nervst und belästigst mich. Es reicht. Wenn Du jetzt nicht sofort Ruhe gibst, schmeisse ich Deinen Teppich raus.» Ich war wild entschlossen, sie wegzuschicken In die ewigen Gefilde oder wohin auch immer sonst. Und notfalls ihren Teppich zu entsorgen.

Der Premier empfing uns mit einem fühlbar echten persönlichen Händedruck, und wir spürten sofort, dass er ein warmherziger Mensch war. Daraufhin lud er uns zum siebengängigen Diner an einen überdimensional grossen Tisch in einem mit Stofftapeten ausgekleideten riesigen Raum. Vom Kaviar bis zum Fruchtsalat aus der Dose führten wir mit ihm ein angeregtes Gespräch, in dem er uns von seiner Herkunft, seinen Studien und vor allem von seinem Land, dem er mit Hingabe und Verpflichtung voranstehen wolle, erzählte. Seine Art, liebevoller Landesvater zu sein, bewegte uns.

Alles taucht in eine zeitlose Stille und ist zugleich in unaufhörlicher nie endender Bewegung. Es gibt nichts ausser den gegenwärtigen Augenblick, von Moment zu Moment, zu Moment, zu Moment…… Nichts ausser absolute Stille in absoluter fortwährender Bewegung.
Ich liebe diesen inneren Raum, den ich mit Rico so oft betreten hatte. Der vollkommen still ist, gefüllt von Liebe und Schönheit. Jenseits von Zeit, nur jetzt, ewig jetzt. Als Rico seinem Ende entgegenging, trafen wir uns dort erneut wieder und wieder. In der Zeitlosigkeit und zugleich bis aufs Äusserste in der Zeit, der knappen Zeit, die er noch zu leben hatte.
Ich realisierte klarer als je zuvor, warum es so schwierig ist, Rico loszulassen. In seinen letzten Wochen waren wir uns so viele Male in diesem unaussprechlichen Raum begegnet. Das hatte ein Band geknüpft, stärker als der Tod.

Vor wenigen Tagen war mein Schwiegervater Gianni gestorben, dem ich zärtlich zugewandt bin. Er war ein in seiner Seele unschuldiger, liebvoller Mensch gewesen. Ich hatte ihn an seinem Todestag im Spital in Chur besucht und zusammen mit Jana, seiner Tochter, von ihm Abschied genommen. Danach fuhr ich weiter Richtung Süden ins Tessin, wo mich sehr bald die Nachricht erreichte, dass er gegangen war. Ich hatte das Buch eines buddhistischen Meditationslehrers im Gepäck. Im Angedenken an Gianni nahm ich es zur Hand und schlug, ohne etwas Bestimmtes zu suchen, eine zufällige Seite auf. Ich landete auf einem Ausschnitt des tibetischen Totenbuches, das den Sterbenden kurz vor und unmittelbar nach ihrem Gehen vorgelesen wird. Wie sehr das doch in diesem Moment passte! Ich las den Text laut vor und richtete ihn in Gedanken an Gianni, um ihn sicher in die andere Welt zu leiten. Er schien verloren, und ich spürte seine «Anwesenheit» im Raum als ob er sich verirrt habe. Danach wirkte er ruhig und ging klar in eine Richtung, die ihn weg von unserem Planeten führte.
Als ich ihr am Schluss ihrer Visite die Frage stellte, ob ich in Lebensgefahr schwebe, schwieg sie für einen Moment und antwortete dann: «Niemand kennt die Stunde eines Menschen, niemand weiss, wann sie kommt. Wir tun unseren Teil als Mediziner. Sie müssen ihren Teil tun: Kämpfen sie! Kämpfen sie weiter!».
Ihre Worte erschreckten mich nicht, sondern machten mir sogar Mut, obwohl – oder vielleicht gerade, weil – sie damit klarmachte, wie knapp es um mich steht. Ihre Art, wie sie es gesagt hatte, hiess für mich, in bis aufs Äusserste zugespitzter Fokussierung weiterzumachen. Gerichtet und zentriert wie ein Pfeil unmittelbar vor dem Abschuss. Es hiess, weiterhin alle meine in den verborgensten Winkeln liegenden Kräfte zu mobilisieren und zu bündeln. Ihre Antwort gab mir einen neuen Kraftschub.
Diese beherzte Frau und Ärztin ermutigte mich mit ihrer Ehrlichkeit. Ihre Klarheit und Eindringlichkeit wirkten wie eine starke Medizin, die direkt in meine Venen floss. Sie gaben mir Rückenwind und befeuerten mich.
Auch sie hat dazu beigetragen, dass ich lebe. Sie hatte Verständnis. Sie betrat den «Seelenraum», von dem aus ich mich an sie gewendet hatte und konnte mir darin begegnen. Damit gab sie mir lebensrettende Unterstützung. Für meinen Kampf, den ich weiterführen musste und wollte.
Mein Kampf breitete sich jedoch nicht nur in der Kontinuität des chronologischen Ablaufes aus. Er entspann sich vor allem innerhalb eines von der Energie meines Überlebenswillens gefüllten Raumes. Die exakte Zeit war dabei nicht mehr der vorherrschende Massstab. Ich hatte einige Erinnerungslücken. Die fortschreitende Bewegung der Zeit, die Abfolge der Ereignisse verschwammen. Teilweise wusste ich nicht, was wann gewesen war, was ich gemacht hatte, ob ich in diesen der Erinnerung entzogenen Momenten gekämpft oder vor mich hingedämmert und sonst irgendetwas getan oder erlebt hatte.
Mein Bewusstsein ordnete stattdessen die verschiedenen Ereignisse rund um meinen Überlebenskampf als zeitloses Zentrum meines Seins an.
Ich spürte ihre Erschütterung und ihre gleichzeitige Gefasstheit. Sie strahlte eine ruhige, geduldige und hingebungsvolle Präsenz aus. Die Art, wie sie meine Füsse massierte, erlebte ich wie eine an mich gerichtete Botschaft: «Bitte bleib hier!» Während ihrer Anwesenheit füllte sie den Raum mit Liebe. Es war eine Liebe, mit der sie mich ganz persönlich meinte und die gleichzeitig unpersönlich und umfassend ist.
Ich lag allein in einem grosszügigen Raum mit Blick auf wunderschöne gelbe Blumen und frühlingshaft spriessende Bäume, durch die der See hindurchschimmerte. Die Blumen blühten direkt vor meinem Fenster in dem auf einer Terrasse vorgelagerten kleinen Garten. So hatte ich -obwohl ich im Obergeschoss war – das Gefühl, ebenerdig zu sein.
Ich musste wohl mit meinem verletzlichen Körper durch die tiefe dunkle Nacht an die Grenze zum Tod gehen, um die Kostbarkeit meines endlichen Lebens lieben zu lernen.

NachtMeerFahrt.
Und damit unzertrennlich verbunden auch die Kostbarkeit meines sterblichen Körpers, der in die ebenso vergänglichen an Bedingungen geknüpftenphysikalischen Gesetze von Raum, Zeit und Gravitation eingebunden ist. Dies körperlich fühlend zu erfassen und zu begreifen, war der Eintritt in ein neues Land, in dem das bisher scheinbar unauflösbare Dilemma zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit nicht mehr existierte. Ich fühlte eine neue ungeahnte Leichtigkeit.
Dann kam der Moment, in dem ich mich traute, auf die mit herrlichen Pflanzen bestandene zum Spital gehörige Terrasse zu gehen. Es fiel mir schwer, aus dem Kokon meiner kleinen Welt, die aus meinem Zimmer, dem Flur und den vertrauten Gesichtern bestand, in einen öffentlichen Raum, an dem sich andere, mir fremde Menschen aufhielten, auszubrechen.
Doch die süsse Verlockung, an die frische Luft hinaus zu gehen obsiegte.
Albert rief mich nichtsahnend an, kurz nachdem ich von der Intensivstation auf die Bettenstation verlegt worden war. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen und auch nichts voneinander gehört. Wir kennen uns seit mehr als dreissig Jahren. In diesem langen Zeitraum hat er mich punktuell immer wieder als Psychologin zu Rate gezogen und sogar eine therapeutische Ausbildung bei mir gemacht. Besonders die Ausbildungszeit führte dazu, dass zusätzlich eine freundschaftliche Herzlichkeit entstanden war.
In seiner verfahrenen Ehekrise suchte er als letzten Rettungsanker nach mir.
Er kam mit einem sorgfältig zusammengestellten farbenfrohen Blumenstrauss. Blumen sind bei mir stets ein Volltreffer, und ich freute mich sehr. Zu meinem eigenen Erstaunen war ich im grenzwertigen Zustand meiner immensen Schwäche in der Lage, ihm Wesentliches mitzugeben. Meine Worte flossen mühelos aus einem inneren Raum des Mitgefühls und eines Wissens um die Essenz des Lebens. Aus diesem innersten Bezirk bahnte sich eine mich übersteigende, ungeahnte Kraft voller Weisheit und Ruhe den Weg nach aussen, die mit Leichtigkeit einfach aus mir hervorsprudelte. Danach war ich tief erschöpft und glücklich. Ich hatte mich als Sprachrohr dieser eindringlichen Energie erlebt und gleichzeitig war ich sie gewesen.
Diesen Raum des Vertrauens auch im Grenzenlosen zu suchen ist mir nichts desto trotz immer noch wichtig. Wenn sich diese Suche aber mit dem Horror angesichts der Sterblichkeit des eigenen Lebens paart, ist es unmöglich, das Geschenk, ein Leben zu haben, voll und ganz in sich aufzunehmen und es tatsächlich zu realisieren. Weil die bange Furcht vor seinem Ende das Staunen und die Freude darüber verdunkelt.

Jetzt sind die Himmelsmütter und die Erdenmutter da.
Die eine durch Raum, Zeit und Schwerkraft limitiert. Befristet. Die vielen, jenseits dieser Gegebenheiten ohne Anfang und Ende. Ewig. Ich spüre, wie sie sich schweigend vermengen, ineinander verweben und durchdringen. Ein Erleben voll gefüllter Stille. Das in mir aufleuchtet. Mich ergreift. Mich umfängt.
Ganz leise. Ohne Worte.
Geräuschlos wie im Frühling im Bild des aufkommenden Windes über dem See.
Barpianisten haben es mir seit meiner Kindheit angetan. Meine Eltern hatten mich bereits als Dreijährige in Bars mitgenommen. Ich erinnere mich greifbar lebhaft an die Besuche in diesen Etablissements, vor allem an den dabei unweigerlich auftauchenden Gefühlszustand. Wie vonmagischer Hand öffnete die schummerige, leicht verruchte Stimmung mit gekonnt geklimperter Live-Musik die Tür in einen Raum des Träumens, nicht wirklich fassbar und genau deshalb, wegen seiner Vagheit und Verschwommenheit, so wohlig und zugleich berückend. Alles und nichts war erträumbar, ein Hauch gleich einer lauen Sommernacht wehte durch meine Gedanken und verzauberte meine Sinne wie ein kaum wahrnehmbarer betörend süsser Duft. Der Reiz lag gerade darin, dass nichts konkret, sondern bloss schemenhaft war und ich mir Jegliches in seiner besten Realisierungsform vorstellen konnte.
Zudem war es, als würde durch die so einfache Tätigkeit, über eine Schwelle zu gehen ein Schleier direkt vor meinen Augen gelüftet, der bislang verhindert hatte, die jetzt durch und durch offensichtliche Zusammengehörigkeit von körperlichen und geistigen Bewegungen zu begreifen: Physisch von einem Raum in einen anderen zu gehen, ist letztlich nichts anderes als über die Schwelle zu treten, die die Welt, in der wir leben von der Welt, die wir in unserem Sterben betreten, trennt.
Auch verbindet?
Ich nahm einfach nicht wahr, wieviel Kraft es mich bislang immer gekostet hatte, rund um die Uhr präsent zu sein und das Geschehen so zu steuern, dass sich für die Gruppe und mich ein gemeinsamer «lebendig sprechender» Raum öffnen kann. Ich war mir nicht bewusst, was es heisst eine Schiffs-Steuerfrau zu sein, die von Moment zu Moment gekonnt auf den Wind, die Strömungen, den Wellengang und die zahllosen weiteren unberechenbaren Variablen eingehen muss, um ihr Schiff sicher durch alle Wetter zu bringen. Ich blendete aus, wie anstrengend und kräftezehrend diese wendige – jeden Moment geforderte – dauernde Wachheit ist.

Das war nicht nur eine willentliche Hinwendung, sondern vor allem ein Sich-Öffnen für meinen inneren Raum voller Geheimnisse. Es bedeutete, mir Zeit zu geben, damit sich das Erlebte ausdehnen und noch tiefer in mein Innerstes vordringen, dort Wurzeln schlagen, anwachsen und gedeihen kann. Als etwas unausweichlich in mir Anwesendes, das mich geduldig und beständig erinnert. «Ich bin das Leben selbst.» Manchmal sanft, andere Male brüsk.

Ich war niedergeschlagen, so weit von der belebenden Intensität entfernt zu sein. Es war, als sei die Tür in diesen Raum zugeschlagen worden. Dieses Mal ging ich in einem völlig anderen Zustand an den Ort, an dem ich nur kurze Zeit davor so innig mit der pulsierenden Lebendigkeit verbunden gewesen war. Insgeheim hoffte ich, wieder dort eintreten zu dürfen.
Das ändert nichts daran, dass der Grundton hinter aller Verbundenheit und sogar der Verschmelzung mit anderen das Allein-Sein ist. Deshalb, weil wir Reisende sind, von Moment zu Moment zu Moment… immer weiter, Reisende durch Raum und Zeit. Aus dem Blickwinkel einer gesamten Lebensspanne betrachtet, reisen wir alle allein durch unser Leben. Wir begegnen einander, bleiben, brechen wieder auf und ziehen weiter. Wir können ineinander aufgehen. Dennoch hört dieser Zustand irgendwann wieder auf. Wenn nicht im Leben, dann an der Tür des trennenden Todes, des eigenen oder des geliebten Anderen. Der Gang über die Schwelle ist ein erneuter radikaler Aufbruch zum alleinigen Weiterreisen. Als Zurückbleibende ebenso wie als Weiterziehende.

Fast nur beiläufig schaute ich ihm aus der schützenden Schwärze des offenen Wohnraumes zu, wie er das an ihm klebende Oberteil mit überkreuzten Armen von unten her fasste und sich über seinen Oberkörper zog, der sich in die Länge streckte und sich mehr und mehr entblösste.
In diesem Moment einer von ihm gewähnten Intimität, für die er sich dezent ein bisschen abseits gestellt hatte.
Aber doch sichtbar. Im Lichtschein der Flurlampe. Für mich.
Für diesen kurzen Moment, in dem ich zufällig und neugierig zu ihm hinschaute und seinen nackten,
straffen, in die Länge gedehnten Oberkörper und seine über den Kopf gestreckten muskulösen Arme sah.
Ein flüchtiger Anblick. Der ein süsses körperliches Sehnen weckte, das mich ungeahnt mitten in meinen Schoss traf und sich von dort nach oben in mein Herz ausdehnte.
Alle Bilder auf dieser Seite Herbert Giller https://rigdrol.com
für alle Bilder gilt: copyright Herbert Giller 2022 – VG-BildKunst – https://www.bildkunst.de